Für manche ist es der nächste logische Schritt in einer modernen Welt. Bequemlichkeit, Sicherheit, Effizienz – das sind die Argumente der Befürworter. Doch hinter der glänzenden Fassade der bargeldlosen Zukunft lauern auch Risiken: Überwachung, Manipulation und der Verlust der Kontrolle über das eigene Geld. Willkommen in der Ära des digitalen Bezahlens – einer Revolution, die leise beginnt, aber laute Konsequenzen haben könnte.
Ein stiller Abschied vom Bargeld
Schweden ist weltweit führend in der Transformation hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Bereits 2021 wurden dort nur noch etwa 9 % aller Zahlungen mit Bargeld abgewickelt, wie die Sveriges Riksbank berichtet. Viele Geschäfte und Restaurants akzeptieren in Schweden gar keine Münzen oder Scheine mehr. In Dänemark und Norwegen sieht es ähnlich aus.
Auch in Deutschland und Österreich holt die bargeldlose Revolution auf. Laut der Deutschen Bundesbank wurden 2022 nur noch 58 % aller Einkäufe mit Bargeld getätigt – ein historischer Tiefststand. Die Corona-Pandemie beschleunigte diesen Trend erheblich, denn plötzlich galt Bargeld als unhygienisch und potenzieller Virenträger.
Doch was passiert, wenn das Bargeld endgültig verschwindet? „Bargeld ist Freiheit“, sagte Franz Schellhorn, österreichischer Wirtschaftsexperte, in einem Interview. Er warnte davor, dass eine bargeldlose Gesellschaft auch eine vollständig überwachte Gesellschaft bedeuten könnte.
Privatsphäre ade: Wer profitiert wirklich?
In einer bargeldlosen Welt gibt es keine anonymen Transaktionen mehr. Jeder Einkauf, jede Zahlung, jedes finanzielle Detail wird registriert und analysiert – von Banken, Zahlungsdienstleistern und oft auch von Dritten. Diese Daten sind nicht nur wertvoll, sondern auch gefährlich in den falschen Händen.
Norbert Häring, Wirtschaftsjournalist und Autor, erklärte in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Die Bargeldabschaffung ist der nächste Schritt in der finanziellen Ausgrenzung.“ Er meint damit, dass nicht nur die Kontrolle über das eigene Geld verloren geht, sondern auch, dass große Teile der Bevölkerung – etwa ältere Menschen oder Geringverdiener – in einem rein digitalen Bezahlsystem abgehängt werden könnten.
China zeigt, wie gefährlich diese Entwicklung sein kann. Im Rahmen des Sozialkredit-Systems werden dort Daten aus Zahlungen, Online-Aktivitäten und Verhalten genutzt, um die Bürger:innen zu bewerten. Ein schlechter „Score“ kann dazu führen, dass jemand keine Kredite mehr erhält, nicht reisen darf oder sogar von öffentlichen Dienstleistungen ausgeschlossen wird.
Die Psychologie des Geldes
Bargeld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern auch ein psychologisches Werkzeug. Studien zeigen, dass Menschen beim Bezahlen mit Bargeld bewusster mit ihrem Geld umgehen. Das physische Gefühl, Scheine und Münzen aus der Hand zu geben, sorgt für eine stärkere Verbindung zum ausgegebenen Betrag.
Eine Studie der Universität Toronto (2016) fand heraus, dass Menschen bei Kartenzahlungen oder kontaktlosen Systemen durchschnittlich 12–18 % mehr Geld ausgeben. Die Forscher führen das auf den „Schmerz des Bezahlens“ zurück, der bei digitalen Transaktionen weniger stark empfunden wird.
Dieser Effekt wird von Unternehmen bewusst genutzt. Je einfacher und unsichtbarer das Bezahlen wird, desto mehr geben wir aus – ein Traum für die Wirtschaft, aber ein Albtraum für unser Portemonnaie.
Die Verlierer der bargeldlosen Welt
Die Verlierer einer bargeldlosen Gesellschaft sind oft jene, die am wenigsten gehört werden. In Schweden protestieren Seniorenverbände gegen die zunehmende Verdrängung des Bargelds. Viele ältere Menschen sind nicht mit digitalen Zahlungsmethoden vertraut und fühlen sich abgehängt.
Auch Menschen ohne Zugang zu Bankkonten oder moderner Technologie stehen vor Problemen. Laut der Weltbank haben weltweit etwa 1,4 Milliarden Erwachsene kein Bankkonto – viele davon in Entwicklungsländern. In einer Welt ohne Bargeld wären diese Menschen vollständig vom Finanzsystem ausgeschlossen.
Selbst in Europa stellt sich die Frage: Was passiert, wenn die Technik versagt? Stromausfälle, technische Störungen oder Hackerangriffe könnten in einer bargeldlosen Gesellschaft katastrophale Folgen haben. „Bargeld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern auch ein Sicherheitsnetz“, erklärte die Deutsche Bundesbank in einem Bericht von 2022.
Fortschritt oder Überwachung?
Die bargeldlose Gesellschaft wird oft als Fortschritt verkauft, als ein Symbol für Modernität und Effizienz. Doch sie birgt auch Risiken, die weit über das Bezahlverhalten hinausgehen. „Wer die Kontrolle über die Daten hat, hat die Kontrolle über die Gesellschaft“, schrieb Shoshana Zuboff in ihrem Buch The Age of Surveillance Capitalism.
Es geht nicht nur darum, wie wir zahlen, sondern darum, wie diese Daten genutzt werden. Ohne klare Regeln und Schutzmechanismen könnten Zahlungsdaten dazu verwendet werden, unser Verhalten zu manipulieren, uns zu überwachen oder uns aus dem System auszuschließen.
Eine Frage der Balance
Das Ende des Bargelds mag unausweichlich erscheinen, aber es ist noch nicht zu spät, über die Folgen nachzudenken. Eine bargeldlose Gesellschaft muss mit starken Datenschutzgesetzen, alternativen Zahlungsmethoden und einem Bewusstsein für die Risiken einhergehen.


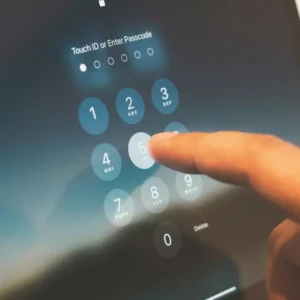










Neueste Kommentare