Schnell entworfene politische Maßnahmen scheitern oft an der Realität – ein Blick nach Italien zeigt, wie gefährlich unkontrollierte Subventionsprogramme sein können. Während die neue Regierung in Österreich den Klimabonus der grünen Leonore Gewessler kassiert, offenbaren aktuelle Untersuchungen in Italien ein völliges Versagen der Kontrollmechanismen.
Mitten in der Coronakrise verabschiedete die Regierung unter Premierminister Giuseppe Conte ein gewaltiges Förderprogramm zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Ziel war es, die Bauindustrie und Handwerksbetriebe zu stützen, wobei die EU Klimaschutzmaßnahmen zur Bedingung machte. Italien wurde als größter Empfänger von EU-Geldern eingeplant.
Doch was als Wirtschaftshilfe gedacht war, wurde zum finanziellen Fiasko. Der „Superbonus 110“ ermöglichte Hausbesitzern, 110 Prozent der Sanierungskosten steuerlich geltend zu machen – 100 Prozent für die Sanierung, zehn Prozent für die Bank, die das Projekt finanzierte.
Ein Jackpot für Immobilienbesitzer – und Betrüger
Für Hausbesitzer bedeutete das Programm eine kostenlose Modernisierung. Solaranlagen, Wärmedämmung, neue Heizkessel – alles wurde ohne eigene Kosten übernommen. Selbst Amateursportvereine konnten ihre Umkleideräume sanieren. Premier Conte pries das Konzept: „Jeder kann sein Zuhause umweltfreundlicher gestalten, ohne einen Cent auszugeben.“
Nach einem verhaltenen Start explodierte die Zahl der Anträge. Baugerüste prägten das Stadtbild Roms und Mailands, doch nicht alle Antragsteller handelten redlich. Der „Superbonus 110“ lud regelrecht zum Betrug ein. Bauunternehmen boten Hausbesitzern sogar Geld an, um deren Immobilien „renovieren“ zu dürfen. Viele Firmen rechneten weitaus höhere Beträge ab, als tatsächlich angefallen waren.
Teilweise wurden Sanierungen abgerechnet, die nie stattfanden. Kriminelle erstellten Rechnungen für Gebäude, die nicht existierten. Die Antimafia-Behörde DIA schätzt, dass die organisierte Kriminalität durch dieses Programm rund zwei Milliarden Euro erbeutete.
Milliardenbetrug und wirtschaftliche Fehlsteuerung
Laut Behörden wurden bis Ende 2023 fast 11.000 Baufirmen eigens gegründet, um von den Steuervorteilen zu profitieren, bevor sie wieder geschlossen wurden. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2021 entstanden täglich 64 neue Unternehmen.
Steuerbehörden ermitteln mittlerweile in Tausenden Fällen, 2,5 Milliarden Euro wurden bereits sichergestellt. Der frühere Finanzminister Daniele Franco sprach 2022 von „einem der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Italienischen Republik“. Auch der damalige Premierminister Mario Draghi kritisierte das „System ohne Kontrolle“ – doch selbst er konnte das Programm nicht stoppen. Erst Giorgia Meloni führte Anfang 2023 strengere Regeln ein, aber da war der Schaden längst angerichtet.
Besonders problematisch war laut einem Bericht in der Welt die Handelbarkeit der Steuergutschriften. Eigentümer konnten ihre Steuervergünstigungen an Banken oder Handwerker verkaufen. Die Gutschriften entwickelten sich zu einer Art Parallelwährung, was Missbrauch erleichterte.
Ein Fass ohne Boden
Ermittler fanden heraus, dass ein Teil der Gelder nicht in Sanierungsmaßnahmen floss, sondern in Kryptowährungen und ins Ausland verschoben wurde. Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti bezifferte den Betrugsschaden bis Februar 2023 auf 16 Milliarden Euro – finanziert von italienischen und europäischen Steuerzahlern.
Das Programm läuft unter veränderten Bedingungen weiter. Ursprünglich waren 35 Milliarden Euro eingeplant, doch die tatsächlichen Kosten sind auf 119 Milliarden Euro gestiegen – das entspricht fünf Prozent des italienischen BIP. Allein 2023 trieben die Superbonus-Kosten das Haushaltsdefizit auf über sieben Prozent.
Mangelnde Effizienz trotz immenser Kosten
Laut Berechnungen des ING-Ökonomen Paolo Pizzoli steigerte der „Superbonus 110“ die Wirtschaftsleistung Italiens zwischen 2021 und 2023 lediglich um zwei Prozent. Nicola Nobile von Oxford Economics bezeichnet das Programm als „die wahrscheinlich schlechteste steuerpolitische Maßnahme der letzten zehn Jahre“.
Die Zentralbank Banca d’Italia kommt in zwei aktuellen Analysen zu ähnlichen Ergebnissen. Zwar kurbelte der Superbonus die Bauaktivität an, doch der wirtschaftliche Nutzen war geringer als die Kosten. Zudem explodierten die Baupreise: Seit Beginn der Pandemie stiegen sie um 20 Prozent, ab September 2021 um weitere 13 Prozent – sieben Prozentpunkte davon direkt durch den Superbonus.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) bemängelt, dass die Maßnahme trotz hoher Kosten nur begrenzte Wachstumseffekte hatte. Höhere Gewinnspannen in der Bauwirtschaft, die Verdrängung anderer Investitionen und der massenhafte Betrug schwächten die erhoffte Wirkung.
Die EU hatte 2020 grünes Licht für das Programm gegeben und es sogar als vorbildlich eingestuft. Heute dürfte man in Brüssel erleichtert sein, dass andere Staaten das Modell nicht übernommen haben.


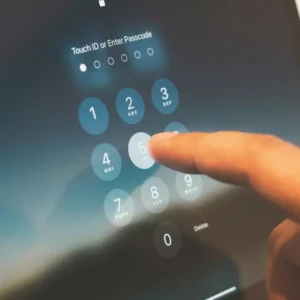



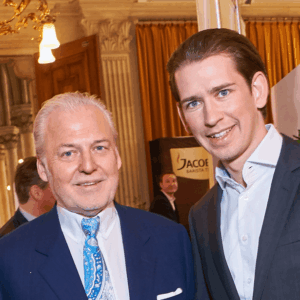






Neueste Kommentare