Die „Bosco della Memoria“ von Bergamo wurde als „lebendiges Denkmal“ konzipierte Erinnerungsstätte am 18. März 2021 feierlich eröffnet. Kein zufälliges Datum, sondern gleichzeitig der erste nationale Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie. Exakt ein Jahr zuvor, im Jahr 2020, gingen die Bilder der Militärkonvois mit den Särgen der Pandemieopfer aus Bergamo um die Welt. Bilder, mit denen etliche Regierungen harte Maßnahmen rechtfertigen sollten. Von den Lockdowns zur Maskenpflicht – zu oft wurden Kritikern die Bilder aus Bergamo vorgehalten. Ein bebildertes Totschlagargument.
Fünf Jahre später präsentiert sich das lebendige Denkmal als karges Areal aus rund 800 Bäumen, Büschen und Sträuchern, deren Anblick in den Wintermonaten eher trostlos wirkt. Bald soll jedoch das erste Grün sprießen und Hoffnung versprühen, so jedenfalls die offizielle Lesart. Doch während die politische Erzählung eine nationale Überwindung der Krise beschwört, sieht die Realität anders aus: Statt andächtigen Besuchern trifft man vor allem Gassigänger, die sich um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht kümmern. Es stinkt, berichten Besucher. So wie vielen Menschen die Aufarbeitung der Pandemie auch stinkt.
Die vermeintlichen “Lastwagen voller Leichen” von Bergamo stehen nun im Zentrum eines heftigen Streits, über den auch die FAZ berichtet. Der Polizeigewerkschafter Antonio Porto behauptete etwa im Dezember 2024 vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass in den Militärfahrzeugen jeweils nur ein Sarg transportiert worden sei. Zwar berief er sich lediglich auf Aussagen von Kollegen, doch der Vorwurf reichte, um Empörung auszulösen und ihm eine Anzeige der Stadt Bergamo wegen der Verbreitung von Fake News einzuhandeln.
Bestatter erklärt, wie es zu den Bildern der Militärlastwagen kam
Doch Porto war nicht der Einzige, der Zweifel äußerte. Auch Alessandro Bosi, Vorsitzender des Verbandes italienischer Bestattungsunternehmen, gab zu bedenken, dass die dramatische Lage auch hausgemacht gewesen sein könnte. Laut Bosi gab es keine offizielle Anordnung zur Kremierung der Leichen, doch Angst vor einer Ansteckung führte dazu, dass viele Angehörige und Behörden Feuerbestattungen forderten. Die Folge: eine Überlastung der Krematorien und improvisierte Lösungen, darunter der Transport der Särge durch das Militär.
Das berühmte Bild der Militärlastwagen, die durch Bergamo rollten, entstand, weil Bestattungsunternehmen wegen Quarantäne ausfielen und die Särge in der Aussegnungshalle des Friedhofs zu lagern begannen. Um eine hygienische Katastrophe zu vermeiden, wurde kurzerhand Verteidigungsminister Lorenzo Guerini kontaktiert, der die Armee entsandte. Ein pragmatischer Akt, der sich jedoch als perfekte Inszenierung für das globale Schreckensszenario eignete.
Die Frage, ob Bergamo aus reiner Zufälligkeit zum ersten großen europäischen Corona-Hotspot wurde oder ob behördliche Versäumnisse die Krise verschärften, ist bis heute ungeklärt. Mehrere Prozesse laufen, in denen Angehörige von Verstorbenen den Behörden eine zu späte Reaktion vorwerfen. Gleichzeitig behaupten Kritiker der Corona-Maßnahmen, dass Angst und Panik gezielt geschürt wurden, um drastische Eingriffe in die Freiheit der Bürger zu rechtfertigen.
Unbestreitbar bleibt jedoch, dass Italien finanziell nicht schlecht aus der Pandemie hervorging. Knapp 200 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds flossen ins Land – sozusagen die Dividende aus der Erzählung von Italiens besonderem Leid. Bergamo selbst hat sich längst erholt. Touristen bevölkern die Altstadt, das Kulturleben blüht, und die Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ kürte die Stadt jüngst zur lebenswertesten Italiens. Doch eines steht fest: Ohne das düstere Kapitel der „Lastwagen von Bergamo“ wäre die Geschichte der triumphalen Wiedergeburt wohl nicht halb so eindrucksvoll.


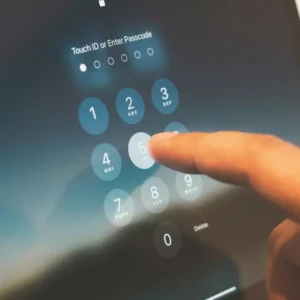










Vorerst gratuliere ich Hr. Schmitt zu diesen neuen Format. Und zum Beitrag „Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit“