Doch warum hält das Band der Kindheit manche zusammen, während andere es durchtrennen? Die Antwort liegt irgendwo zwischen Psychologie, Zufall und ein paar tief sitzenden Kindheitsnarben.
Der Psychologe Frank Sulloway von der Harvard University hat untersucht, wie die Geburtsreihenfolge das Selbstbild von Geschwistern formt. Erstgeborene, so seine Forschung, wachsen oft mit einem starken Pflichtgefühl auf, während jüngere Geschwister rebellischer werden, weil sie sich gegen den bereits etablierten „Platzhirsch“ behaupten müssen. Dieser ungleiche Start ins Leben beeinflusst nicht nur die Kindheit, sondern kann sich auch in der Erwachsenenbeziehung widerspiegeln. Wer als Kind immer der Verantwortliche war, wird oft auch später der „Kümmerer“. Wer sich als ewiger Zweiter fühlte, wird vielleicht irgendwann auf Distanz gehen.
Der ewige Kampf um Aufmerksamkeit
Manche Geschwisterbeziehungen sind nichts anderes als ein nie endender Konkurrenzkampf. Die Psychologin Laurie Kramer von der University of Illinois hat in Langzeitstudien gezeigt, dass der frühe Kampf um elterliche Anerkennung oft nachhallt. Ein Kind, das sich im Schatten des anderen fühlte, kann dieses Gefühl auch als Erwachsener nicht einfach ablegen. Kramer fand heraus, dass Geschwister, die als Kinder um elterliche Liebe konkurrierten, später oft weniger emotionalen Kontakt zueinander haben.
Interessanterweise, so Kramer, sind es nicht zwangsläufig die Streithähne, die sich später entfremden – sondern jene, die Konflikte nie offen austragen durften. Wenn ein unausgesprochener Konkurrenzkampf Jahre lang schwelt, kann er sich in einem wortlosen Rückzug entladen.
Warum manche Geschwister den Kontakt abbrechen
Nicht jede Entfremdung hat einen dramatischen Auslöser. Manchmal reicht ein schleichendes Gefühl der Ungerechtigkeit. Jill Suitor von der Purdue University untersuchte über 700 Geschwisterpaare und fand heraus, dass der häufigste Grund für langfristigen Kontaktabbruch die wahrgenommene Ungleichbehandlung durch die Eltern ist.
Das Besondere: Nicht die tatsächliche Bevorzugung eines Kindes führte zum Bruch, sondern das subjektive Gefühl der Benachteiligung. Selbst wenn Eltern glaubten, alle gleich zu behandeln, fühlten sich manche Kinder übergangen – und dieses Gefühl zog sich wie ein roter Faden durch das gesamte Erwachsenenleben.
„Wenn ein Geschwisterkind sich dauerhaft als das ‚weniger geliebte‘ wahrnimmt, kann das eine Distanz schaffen, die sich später nicht mehr einfach überbrücken lässt“, schreibt Suitor in ihrer Analyse. Besonders dann, wenn Eltern ihre Vorzugsbehandlung über Jahre hinweg fortsetzen – etwa durch finanzielle Unterstützung oder emotionale Nähe im Erwachsenenalter – wird die Beziehung oft dauerhaft beschädigt.
Kommen sie wieder zusammen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Die Entfremdung muss aber nicht endgültig sein. Karen Fingerman, Professorin für Psychologie an der University of Texas, fand heraus, dass Geschwister oft durch Krisen oder Verluste wieder zusammenfinden. In ihren Studien zeigte sich, dass ein einschneidendes Ereignis – wie der Tod eines Elternteils oder eine schwere persönliche Krise – oft ein Auslöser dafür ist, dass Geschwister ihre Differenzen zumindest teilweise überwinden.
Doch nicht immer gelingt das. Laut Fingerman erkennen viele nach Jahren der Distanz, dass sie zwar eine gemeinsame Vergangenheit, aber keine gemeinsame Zukunft haben. Das Gefühl, dass nur das Geschwisterkind die eigene Kindheit wirklich versteht, reicht nicht immer aus, um eine Beziehung wieder aufzubauen.
Kein Happy End garantiert
Manche Geschwister bleiben für immer Seite an Seite. Andere verlieren sich unterwegs. Und manchmal ist die größte Wahrheit über Familie, dass es keine Regeln gibt.
Blut mag dicker als Wasser sein – aber manchmal ist es auch einfach nur eine alte Geschichte, die man nicht mehr weiterschreiben will.


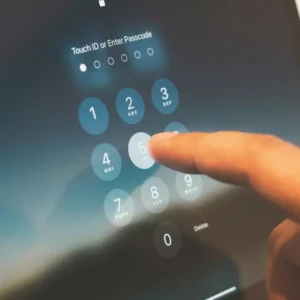





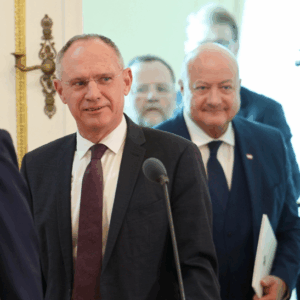




Neueste Kommentare