Seit Jahren beschäftigt sich eine Journalistin mit Fragen der Gleichberechtigung – nicht nur zwischen Frauen und Männern, sondern zunehmend auch zwischen Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Nach intensiven Gesprächen mit NGOs, die sich für Gleichstellung im Berufsleben einsetzen, hat Sie begonnen, ein Feld zu beleuchten, das bisher kaum in den Fokus öffentlicher Debatten gerückt ist: den diplomatischen Dienst.
Eine große Bühne
Die Welt der Diplomatie ist eine Bühne, auf der Worte und Gesten sorgfältig gewählt, Images kultiviert und Identitäten oft strategisch angepasst werden müssen. Besonders heikel wird es dann, wenn die private Identität im Widerspruch zu den Erwartungen des Herkunftslandes steht – wie im Fall jenes Botschafters, den man im Zuge der Recherchen begegnet ist.
Er ist im besten Alter, charmant, auffallend gekleidet, Vater zweier Kinder, Moslem – und homosexuell. Seit Jahren vertritt er ein eher konservatives Heimatland in Wien. Nur wenige Eingeweihte wissen von seinem Geheimnis. Nicht einmal seine Frau kennt seine wahre sexuelle Orientierung. Sie lebt mit den Kindern ein schönes Leben in der Wiener Hauptstadt, während er, beruflich in Österreich viel unterwegs ist und ein anderes, verborgenes Leben führt.
Homosexualität als Druckmittel
In Wien, fernab der strengen moralischen Maßstäbe seiner Heimat, gönnt er sich gelegentlich die Freiheit, in anonymen Clubs seine wahre Identität zu leben. Doch selbst hier ist Vorsicht geboten. Der Geheimdienst seines Landes könnte längst über seine Aktivitäten Bescheid wissen. In autoritären Systemen sind persönliche Schwächen – oder das, was als solche betrachtet werden – oft politisches Druckmittel. Das Wissen über seine Homosexualität könnte ihm zum Verhängnis werden. Die Gefahr: Erpressung, politische Ergebenheit oder das abrupte Ende einer diplomatischen Karriere.
Leben im Schatten
Dass der Botschafter homosexuell ist, widerspricht nicht nur dem offiziellen moralischen Kodex seiner Regierung, sondern auch der religiösen Prägung des Landes. Dort wäre ein Coming-out nicht nur ein Karrierekiller, sondern potenziell eine existenzielle Bedrohung für ihn und seine politischen Partei. In seiner Heimat, einem malerischen Land am Meer, lebt er seine Sehnsüchte im Verborgenen – bei seinen Liebhabern, die ebenso im Schatten bleiben müssen.
Sein Traum: In der Pension seine Ehe zu beenden und sich ganz seinem wahren Leben zu widmen – in jenem Land, das ihm einst die Freiheit schenkte, er selbst zu sein. Doch noch ist es nicht so weit. Noch spielt er das Spiel der Diplomatie. Noch zeigt er bei offiziellen Anlässen das Bild des pflichtbewussten Ehemanns und loyalen Repräsentanten seines Landes, das seine wahre Identität niemals akzeptieren würde.
Ein Tabu
Was sagt uns dieser Fall? Vor allem dies: Dass Gleichstellung in der internationalen Politik noch immer an nationalen Realitäten scheitert. Während in vielen westlichen Ländern Offenheit und Diversität – zumindest auf dem Papier – zum Standard gehören, ist in anderen Teilen der Welt jede Abweichung von der Norm ein Tabu.
Homosexuelle Diplomaten führen oft ein Leben im Spagat – zwischen öffentlicher Repräsentation und privater Verleugnung. Und auch in westlichen Staaten bleibt das Thema oft unausgesprochen. Es fehlt an Solidarität, an Schutzmechanismen, an öffentlicher Diskussion.
Wenn wir über Gleichstellung sprechen, dürfen wir nicht bei Genderquoten oder Lohngerechtigkeit stehenbleiben. Wir müssen auch jene hören, die ihre Identität nur im Verborgenen leben können – selbst in den höchsten Kreisen der Macht.
Redaktions-Team


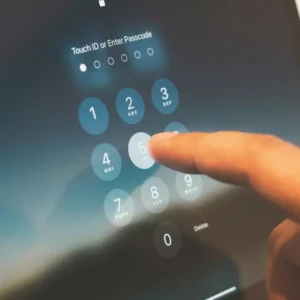




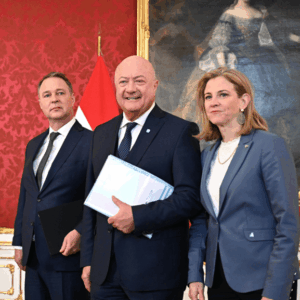





Und jetzt ganz ehrlich, wen, außer die Betroffenen interessiert bzw. betrifft das jetzt ernsthaft?
Wir haben glaube ich andere Probleme als einen schwulen Moslem, oder?