Die heute präsentierten Daten der Statistik Austria bestätigen den „Worst Case“: Im Jahr 2024 betrug das öffentliche Defizit laut Zahlen der Statistik Austria 4,7 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – das sind 22,5 Milliarden Euro.
Der öffentliche Schuldenstand erhöhte sich um 22,6 Milliarden Euro auf 394,1 Milliarden Euro zu Jahresende 2024.
Die Schuldenquote – das Verhältnis der Staatsschulden zur nominellen Wirtschaftsleistung – stieg von 78,5 % auf 81,8 %.
„Die anhaltende Wirtschaftskrise schlägt auf die Staatsfinanzen durch und hat das Budgetdefizit im Jahr 2024 auf 4,7 % ansteigen lassen. Damit hat sich Österreich weiter von der 3 %-Maastricht-Grenze entfernt. Neben dem Rückgang der Wirtschaftsleistung hat insbesondere der Anstieg der Staatsausgaben um 8,8 % zum Defizit beigetragen, vor allem getrieben von den Gehaltsabschlüssen für den öffentlichen Dienst, den Anpassungen der Pensionen sowie der Valorisierung der Sozialleistungen. Die Steuereinnahmen sind hingegen weniger kräftig um 4,0 % gestiegen. Der österreichische Staat war Ende 2024 mit 42 849 Euro pro Kopf der Bevölkerung verschuldet“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.
Damit ist ziemlich klar: Österreich erwartet ein EU-Defizitverfahren – die Republik wird unter finanztechnisch Kuratel gestellt. Während Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) meinte, dass sei „kein Beinbruch“, kritisiert die FPÖ diese Entwicklung mit einem weiteren Verlust der Eigenstaatlichkeit Österreichs massiv.
Hintergrund: Die Nachteile eines EU-Defizitverfahrens
Ein EU-Defizitverfahren – offiziell als Verfahren bei einem übermäßigen Defizit bezeichnet – wird eingeleitet, wenn ein Mitgliedstaat gegen die im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten Haushaltsregeln verstößt. Konkret betrifft dies ein jährliches Haushaltsdefizit von über 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder eine Staatsverschuldung von über 60 % des BIP ohne erkennbare Annäherung an diesen Referenzwert. Das Verfahren ist mit einer Reihe von Nachteilen für den betroffenen Mitgliedstaat verbunden, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer Ebene.
Ein zentrales Risiko besteht im Verlust des Vertrauens der Finanzmärkte. Staaten, gegen die ein Defizitverfahren eröffnet wurde, werden häufig als weniger kreditwürdig wahrgenommen. In der Folge steigen oftmals die Zinssätze für Staatsanleihen, was die Refinanzierungskosten erhöht und zusätzliche Belastungen für den Staatshaushalt mit sich bringt.
Darüber hinaus erhöht sich der politische und finanzielle Druck seitens der EU-Kommission. Im Rahmen des Verfahrens spricht die Kommission konkrete Empfehlungen aus, wie der betroffene Staat sein Haushaltsdefizit abbauen soll. Dies kann beispielsweise durch Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen oder Strukturreformen geschehen. Solche Maßnahmen schränken den nationalen politischen Handlungsspielraum ein und stoßen insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf Widerstand innerhalb der Bevölkerung.
Ein weiteres Risiko besteht in möglichen Sanktionen. Kommt der betroffene Staat den Empfehlungen der Kommission nicht ausreichend nach, können finanzielle Sanktionen verhängt werden, darunter Geldstrafen oder das Einfrieren von EU-Mitteln, etwa aus den Strukturfonds. Insbesondere wirtschaftlich schwächere Mitgliedstaaten wären davon stark betroffen.
Ein häufig kritisierter Nebeneffekt eines Defizitverfahrens ist der Zwang zu Sparmaßnahmen, der sogenannte Austeritätskurs. Um die EU-Vorgaben zu erfüllen, sehen sich viele Regierungen gezwungen, Investitionen zu kürzen oder Sozialausgaben zu reduzieren. Diese Maßnahmen können jedoch konjunkturell nachteilig wirken und das wirtschaftliche Wachstum hemmen, was wiederum die Rückführung der Schulden erschwert. In einem solchen Umfeld kann ein wirtschaftlicher Teufelskreis entstehen.
Nicht zuletzt bergen Defizitverfahren ein erhebliches innenpolitisches Konfliktpotenzial. Die Wahrnehmung eines äußeren Eingriffs in nationale Haushaltsentscheidungen kann populistische oder EU-kritische Strömungen stärken und das Vertrauen der Bevölkerung in europäische Institutionen schwächen.
Insgesamt zeigt sich, dass ein EU-Defizitverfahren mit vielfältigen negativen Konsequenzen für betroffene Mitgliedstaaten verbunden ist. Neben wirtschaftlichen Belastungen und politischem Druck auf nationaler Ebene kann es langfristig auch zu wachsender EU-Skepsis innerhalb der Gesellschaft führen.


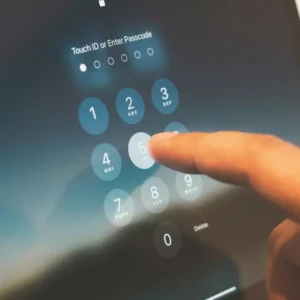



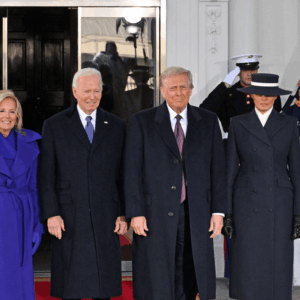






VdB müsste zum Rücktritt gezwungen werden denn er hat verhindert, dass Kickl den Staatshaushalt so weit saniert hätte, dass wir nicht unter die Fuchtel der EU fallen würden.